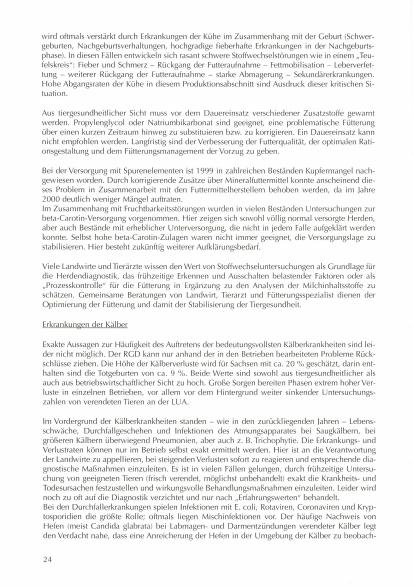
wird oftmals verstärkt durch Erkrankungen der Kühe im Zusammenhang mit der Geburt (Schwer-
geburten, Nachgeburtsverhaltungen, hochgradige fieberhafte Erkrankungen in der Nachgeburts-
phase). In diesen Fällen entwickeln sich rasant schwere Stoffwechselstörungen wie in einem "Teu-
felskreis"; Fieber und Schmerz - Rückgang der Futteraufnahme - Fettmobilisation - Leberverfet-
tung - weiterer Rückgang der Futteraufnahme - starke Abmagerung - Sekundärerkrankungen.
Hohe Abgangsraten der Kühe in diesem Produktionsabschnitt sind Ausdruck dieser kritischen Si-
tuation.
Aus tiergesundheitlicher Sicht muss vor dem Dauereinsatz verschiedener Zusatzstoffe gewarnt
werden. Propylenglycol oder Natriumbikarbonat sind geeignet, eine problematische Fütterung
über einen kurzen Zeitraum hinweg zu substituieren bzw. zu korrigieren. Ein Dauereinsatz kann
nicht empfohlen werden. Langfristig sind der Verbesserung der Futterqualität, der optimalen Rati-
onsgestaltung und dem Fütterungsmanagement der Vorzug zu geben.
Bei der Versorgung mit Spurenelementen ist 1999 in zahlreichen Beständen Kupfermangel nach-
gewiesen worden. Durch korrigierende Zusätze über Mineralfuttermittel konnte anscheinend die-
ses Problem in Zusammenarbeit mit den Futtermittelherstellern behoben werden, da im Jahre
2000 deutlich weniger Mängel auftraten.
Im Zusammenhang mit Fruchtbarkeitsstörungen wurden in vielen Beständen Untersuchungen zur
beta-Carotin-Versorgung vorgenommen. Hier zeigen sich sowohl völlig normal versorgte Herden,
aber auch Bestände mit erheblicher Unterversorgung, die nicht in jedem Falle aufgeklärt werden
konnte. Selbst hohe beta-Carotin-Zulagen waren nicht immer geeignet, die Versorgungslage zu
stabilisieren. Hier besteht zukünftig weiterer Aufklärungsbedarf.
Viele Landwirte und Tierärzte wissen den Wert von Stoffwechseluntersuchungen als Grundlage für
die Herdendiagnostik, das frühzeitige Erkennen und Ausschalten belastender Faktoren oder als
.Prozesskontrolle"
für die Fütterung in Ergänzung zu den Analysen der Milchinhaltsstoffe zu
schätzen. Gemeinsame Beratungen von Landwirt, Tierarzt und Fütterungsspezialist dienen der
Optimierung der Fütterung und damit der Stabilisierung der Tiergesundheit.
Erkrankungen der Kälber
Exakte Aussagen zur Häufigkeit des Auftretens der bedeutungsvollsten Kälberkrankheiten sind lei-
der nicht möglich. Der RGD kann nur anhand der in den Betrieben bearbeiteten Probleme Rück-
schlüsse ziehen. Die Höhe der Kälberverluste wird für Sachsen mit ca. 20 % geschätzt, darin ent-
halten sind die Totgeburten von ca. 9
%.
Beide Werte sind sowohl aus tiergesundheitlicher als
auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu hoch. Große Sorgen bereiten Phasen extrem hoher Ver-
luste in einzelnen Betrieben, vor allem vor dem Hintergrund weiter sinkender Untersuchungs-
zahlen von verendeten Tieren an der LUA.
Im Vordergrund der Kälberkrankheiten standen - wie in den zurückliegenden Jahren - Lebens-
schwäche, Durchfallgeschehen und Infektionen des Atmungsapparates bei Saugkälbern, bei
größeren Kälbern überwiegend Pneumonien, aber auch z. B. Trichophytie. Die Erkrankungs- und
Verlustraten können nur im Betrieb selbst exakt ermittelt werden. Hier ist an die Verantwortung
der Landwirte zu appellieren, bei steigenden Verlusten sofort zu reagieren und entsprechende dia-
gnostische Maßnahmen einzuleiten. Es ist in vielen Fällen gelungen, durch frühzeitige Untersu-
chung von geeigneten Tieren (frisch verendet, möglichst unbehandelt) exakt die Krankheits- und
Todesursachen festzustellen und wirkungsvolle Behandlungsmaßnahmen einzuleiten. Leider wird
noch zu oft auf die Diagnostik verzichtet und nur nach "Erfahrungswerten" behandelt.
Bei den Durchfallerkrankungen spielen Infektionen mit E. coli, Rotaviren. Coronaviren und Kryp-
tosporidien die größte Rolle; oftmals liegen Mischinfektionen vor. Der häufige Nachweis von
Hefen (meist Candida glabrata) bei Labmagen- und Darmentzündungen verendeter Kälber legt
den Verdacht nahe, dass eine Anreicherung der Hefen in der Umgebung der Kälber zu beobach-
24