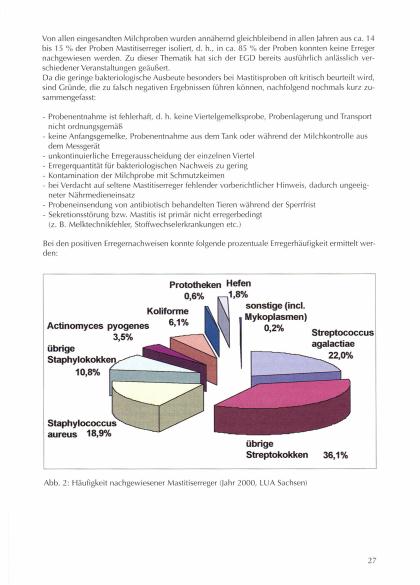
Von allen eingesandten Milchproben wurden annähernd gleichbleibend
in allen Jahren aus ca. 14
bis 15 % der Proben Mastitiserreger isoliert, d. h., in ca. 85 % der Proben konnten keine Erreger
nachgewiesen werden. Zu dieser Thematik hat sich der EGD bereits ausführlich anlässlich
ver-
schiedener Veranstaltungen geäußert.
Da die geringe bakteriologische Ausbeute besonders bei Mastitisproben oft kritisch beurteilt wird,
sind Gründe, die zu falsch negativen Ergebnissen führen können, nachfolgend nochmals kurz zu-
sammengefasst:
- Probenentnahme ist fehlerhaft, d. h. keine Viertelgemelksprobe, Probenlagerung und Transport
nicht ordnungsgemäß
- keine Anfangsgemelke, Probenentnahme aus dem Tank oder während der Milchkontrolle aus
dem Messgerät
- unkontinuierliche Erregerausscheidung der einzelnen Viertel
- Erregerquantität für bakteriologischen Nachweis zu gering
- Kontamination der Milchprobe mit Schmutzkeimen
- bei Verdacht auf seltene Mastitiserreger fehlender vorberichtlicher Hinweis, dadurch ungeeig-
neter Nährmedieneinsatz
- Probeneinsendung
von
antibiotisch behandelten Tieren während der Sperrfrist
- Sekretionsstörung bzw. Mastitis ist primär nicht erregerbedingt
(z. B. Melktechnikfehler, Stoffwechselerkrankungen etc.)
Bei den positiven Erregernachweisen konnte folgende prozentuale Erregerhäufigkeit ermittelt wer-
den:
übrige
Streptokokken 36,1%
Prototheken Hefen
0,6% 1,8%
Koliforme
~ sonstige (incl.
Mykoplasmen)
Actinomyces pyogenes 6,1%
02°1
, 10
Streptococcus
3,5%
agalactiae
22,0%
übrige
Staphylokokken
10,8%
Staphylococcus
aureus 18,9%
Abb. 2: Häufigkeit nachgewiesener Mastitiserreger (Jahr 2000, LUA Sachsen)
27