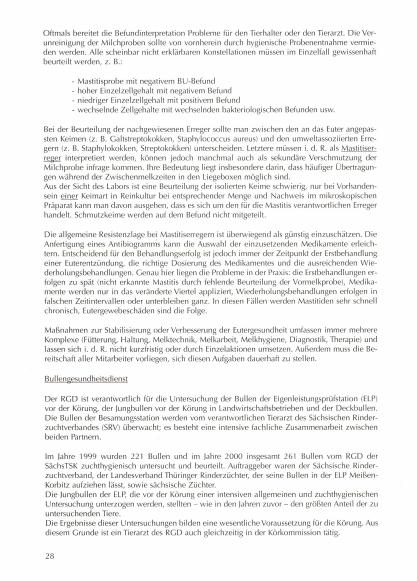
Oftmals bereitet die Befundinterpretation Probleme für den Tierhalter oder den Tierarzt. Die Ver-
unreinigung der Milchproben sollte von vornherein durch hygienische, Probenentnahme vermie-
den werden, Alle scheinbar nicht erklärbaren Konstellationen müssen im Einzelfall gewissenhaft
beurteilt werden,
z:
B,:
- Mastitisprobe mit negativem BU-Befund
- hoher Einzelzellgehalt mit negativem Befund
- niedriger Einzelzellgehalt mit positivem Befund
- wechselnde Zellgehalte mit wechselnden bakteriologischen Befunden usw.
Bei der Beurteilung der nachgewiesenen Erreger sollte man zwischen den an das Euter angepas-
sten Keimen (z. B, Galtstreptokokken, Staphylococcus aureus) und den umweltassoziierten Erre-
gern (z. B, Staphylokokken, Streptokokken) unterscheiden, Letztere müssen i, d. R, als Mastitiser-
reger interpretiert werden, können jedoch manchmal auch als sekundäre Verschmutzung der
Milchprobe
infrage kommen, Ihre Bedeutung liegt insbesondere darin, dass häufiger Übertragun-
gen während der Zwischenmelkzeiten
in den Liegeboxen möglich sind,
Aus der Sicht des Labors ist eine Beurteilung der isolierten Keime schwierig, nur bei Vorhanden-
sein einer Keimart in Reinkultur bei entsprechender Menge und Nachweis im mikroskopischen
Präparat kann man davon ausgehen, dass es sich um den für die Mastitis verantwortl ichen Erreger
handelt. Schmutzkeime werden auf dem Befund nicht mitgeteilt.
Die allgemeine Resistenzlage bei Mastitiserregern ist überwiegend als günstig einzuschätzen, Die
Anfertigung eines Antibiogramms kann die Auswahl der einzusetzenden Medikamente erleich-
tern, Entscheidend für den Behandlungserfolg ist jedoch immer der Zeitpunkt der Erstbehandlung
einer Euterentzündung, die richtige Dosierung des Medikamentes und die ausreichenden Wie-
derholungsbehandlungen, Genau hier liegen die Probleme in der Praxis: die Erstbehandlungen er-
folgen zu spät (nicht erkannte Mastitis durch fehlende Beurteilung der Vormelkprobe), Medika-
mente werden nur in das veränderte Viertel appliziert, Wiederholungsbehandlungen erfolgen in
falschen Zeitintervallen oder unterbleiben ganz, In diesen Fällen werden Mastitiden sehr schnell
chronisch, Eutergewebeschäden sind die Folge,
Maßnahmen zur Stabilisierung oder Verbesserung der Eutergesundheit umfassen immer mehrere
Komplexe (Fütterung, Haltung, Melktechnik, Melkarbeit, Melkhygiene, Diagnostik, Therapie) und
lassen sich i. d. R, nicht kurzfristig oder durch Einzelaktionen umsetzen, Außerdem muss die Be-
reitschaft aller Mitarbeiter vorliegen, sich diesen Aufgaben dauerhaft zu stellen,
Bu liengesundheitsdienst
Der RGD ist verantwortlich für die Untersuchung der Bullen der Eigenleistungsprüfstation (ELP)
vor der Körung, der Jungbullen vor der Körung in Landwirtschaftsbetrieben und der Deckbullen.
Die Bullen der Besamungsstation werden vom verantwortlichen Tierarzt des Sächsischen Rinder-
zuchtverbandes (SRV) überwacht; es besteht eine intensive fachliche Zusammenarbeit zwischen
bei den Partnern,
Im Jahre 1999 wurden 221 Bullen und im Jahre 2000 insgesamt 261 Bullen vom RGD der
SächsTSK zuchthygienisch untersucht und beurteilt. Auftraggeber waren der Sächsische Rinder-
zuchtverband. der Landesverband Thüringer Rinderzüchter, der seine Bullen in der ELP Meißen-
Korbitz aufziehen lässt, sowie sächsische Züchter,
Die Jungbullen der ELP,die vor der Körung einer intensiven allgemeinen und zuchthygienischen
Untersuchung unterzogen werden, stellten - wie in den Jahren zuvor - den größten Anteil der zu
untersuchenden Tiere,
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden eine wesentliche Voraussetzung für die Körung, Aus
diesem Grunde ist ein Tierarzt des RGD auch gleichzeitig in der Körkommission tätig,
28