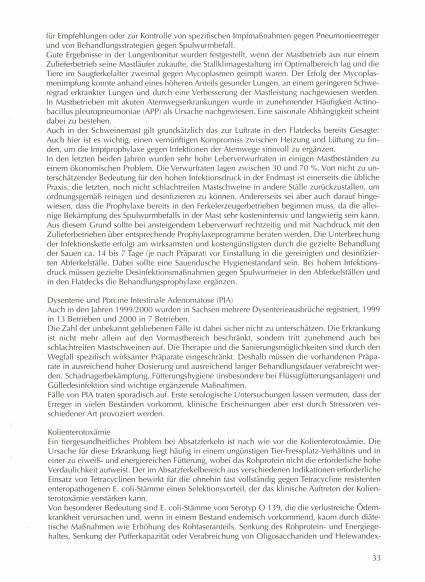
für Empfehlungen oder zur Kontrolle von spezifischen Impfmaßnahmen gegen Pneumonieerreger
und von Behandlungsstrategien gegen Spulwurmbefall.
Gute Ergebnisse in der Lungenbonitur wurden festgestellt, wenn der Mastbetrieb aus nur einem
Zulieferbetrieb seine Mastläufer zu kaufte, die Stallklimagestaltung
im Optimalbereich
lag und die
Tiere im Saugferkelalter zweimal gegen Mycoplasmen geimpft waren. Der Erfolg der Mycoplas-
menimpfung konnte an hand eines höheren Anteils gesunder Lungen, an einem geringeren Schwe-
regrad erkrankter Lungen und durch eine Verbesserung der Mastleistung nachgewiesen werden.
In Mastbetrieben mit akuten Atemwegserkrankungen wurde in zunehmender Häufigkeit Actine-
bacillus pleuropneumoniae (APP) als Ursache nachgewiesen. Eine saisonale Abhängigkeit scheint
dabei zu bestehen.
Auch in der Schweinemast gilt grundsätzlich das zur Luftrate in den Flatdecks bereits Gesagte:
Auch hier ist es wichtig, einen vernünftigen Kompromiss zwischen Heizung und Lüftung zu fin-
den, um die Impfprophylaxe gegen Infektionen der Atemwege sinnvoll zu ergänzen.
In den letzten beiden Jahren wurden sehr hohe Leberverwurfraten
in einigen Mastbeständen zu
einem ökonomischen Problem. Die Verwurfraten lagen zwischen 30 und 70 %. Von nicht zu un-
terschätzender Bedeutung für den hohen Infektionsdruck in der Endmast ist einerseits die übliche
Praxis, die letzten, noch nicht schlachtreifen Mastschweine in andere Ställe zurückzustallen, um
ordnungsgemäß reinigen und desinfizieren zu können. Andererseits sei aber auch darauf hinge-
wiesen, dass die Prophylaxe bereits in den Ferkelerzeugerbetrieben beginnen muss, da die allei-
nige Bekämpfung des Spulwurmbefalls
in der Mast sehr kostenintensiv und langwierig sein kann.
Aus diesem Grund sollte bei ansteigendem Leberverwurf rechtzeitig und mit Nachdruck mit den
Zulieferbetrieben über entsprechende Prophylaxeprogramme beraten werden. Die Unterbrechung
der Infektionskette erfolgt am wirksamsten und kostengünstigsten durch die gezielte Behandlung
der Sauen ca. 14 bis 7 Tage (je nach Präparat) vor Einstallung in die gereinigten und desinfizier-
ten Abferkelställe. Dabei sollte eine Sauendusche Hygienestandard sein. Bei hohem Infektions-
druck müssen gezielte Desinfektionsmaßnahmen gegen Spulwurmeier in elen Abferkelställen und
in den Flatdecks die Behandlungsprophylaxe ergänzen.
Dysenterie und Porcine Intestinale Adenomatose (PIA)
Auch in den Jahren 1999/2000 wurden in Sachsen mehrere Dysenterieausbrüche registriert, 1999
in 13 Betrieben und 2000 in 7 Betrieben.
Die Zahl der unbekannt gebliebenen Fälle ist dabei sicher nicht zu unterschätzen. Die Erkrankung
ist nicht mehr allein auf den Vormastbereich beschränkt, sondern tritt zunehmend auch bei
schlachtreifen Mastschweinen auf. Die Therapie und die Sanierungsmöglichkeiten sind durch den
Wegfall spezifisch wirksamer Präparate eingeschränkt. Deshalb müssen die vorhandenen Präpa-
rate in ausreichend hoher Dosierung und ausreichend langer Behandlungsdauer verabreicht wer-
den. Schaelnagerbekämpfung, Fütterungshygiene (insbesondere bei Flüssigfütterungsanlagen) und
Gülledesinfektion sind wichtige ergänzende Maßnahmen.
Fälle von PIA traten sporadisch auf. Erste serologische Untersuchungen lassen vermuten, dass der
Erreger in vielen Beständen vorkommt, klinische Erscheinungen aber erst durch Stressoren ver-
schiedener Art provoziert werden.
Kolienterotoxämie
Ein tiergesundheitliches Problem bei Absatzferkeln ist nach wie vor die Kolienterotoxämie. Die
Ursache für diese Erkrankung liegt häufig in einem ungünstigen Tier-Fressplatz-Verhältnis und in
einer zu eiweiß- und energiereichen Fütterung, wobei das Rohprotein nicht die erforderliche hohe
Verdaulichkeit aufweist. Der im Absatzferkelbereich aus verschiedenen Indikationen erforderliche
Einsatz von Tetracyclinen bewirkt für die ohnehin fast vollständig gegen Tetracycline resistenten
enteropathogenen E. coli-Stämme einen Selektionsvorteil. der das klinische Auftreten der Kolien-
terotoxämie verstärken kann.
Von besonderer Bedeutung sind E. coli-Stämme vom Serotyp 0139, die die verlustreiche Ödem-
krankheit verursachen und, wenn in einem Bestand endemisch vorkommend, kaum durch diäte-
tische Maßnahmen wie Erhöhung des Rohfaseranteils, Senkung des Rohprotein- und Energiege-
haltes, Senkung der Pufferkapazität oder Verabreichung von Oligosacchariden und Hefewandex-
33