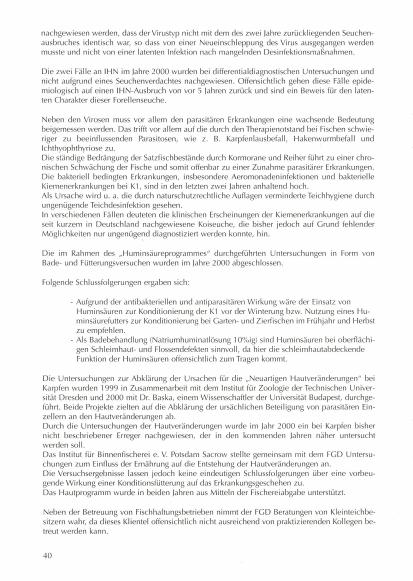
nachgewiesen werden, dass derVirustyp nicht mit dem des zwei Jahre zurückliegenden Seuchen-
ausbruches identisch war, so dass von einer Neueinschleppung des Virus ausgegangen werden
musste und nicht von einer latenten Infektion nach mangelnden Desinfektionsmaßnahmen.
Die zwei Fälle an IHN im Jahre 2000 wurden bei differentialdiagnostischen Untersuchungen und
nicht aufgrund eines Seuchenverdachtes nachgewiesen. Offensichtlich gehen diese Fälle epide-
miologisch auf einen IHN-Ausbruch von vor 5 Jahren zurück und sind ein Beweis für den laten-
ten Charakter dieser Forellenseuche.
Neben den Virosen muss vor allem den parasitären Erkrankungen eine wachsende Bedeutung
beigemessen werden. Das trifft vor allem auf die durch den Therapienotstand bei Fischen schwie-
riger zu beeinflussenden Parasitosen, wie z. B. Karpfenlausbefall, Hakenwurmbefall und
Ichthyophthyriose zu.
Die ständige Bedrängung der Satzfischbestände durch Kormorane und Reiher führt zu einer chro-
nischen Schwächung der Fische und somit offenbar zu einer Zunahme parasitärer Erkrankungen.
Die bakteriell bedingten Erkrankungen, insbesondere Aeromonadeninfektionen und bakterielle
Kiemenerkrankungen bei K1, sind in den letzten zwei Jahren anhaltend hoch.
Als Ursache wird u. a. die durch naturschutzrechtliche Auflagen verminderte Teichhygiene durch
ungenügende Teichdesinfektion gesehen.
In verschiedenen Fällen deuteten die klinischen Erscheinungen der Kiemenerkrankungen auf die
seit kurzem in Deutschland nachgewiesene Koiseuche, die bisher jedoch auf Grund fehlender
Möglichkeiten nur ungenüge~d diagnostiziert werden konnte, hin.
Die im Rahmen des .Huminsäureprograrnrnes" durchgeführten Untersuchungen
in Form von
Bade- und Fütterungsversuchen wurden im Jahre 2000 abgeschlossen.
Folgende Schlussfolgerungen ergaben sich:
- Aufgrund der antibakteriellen und antiparasitären Wirkung wäre der Einsatz von
Huminsäuren zur Konditionierung der K1 vor der Winterung bzw. Nutzung eines Hu-
minsäurefutters zur Konditionierung bei Garten- und Zierfischen im Frühjahr und Herbst
zu empfehlen.
- Als Badebehandlung (Natriumhuminatlösung 1O%ig) sind Huminsäuren bei oberflächi-
gen Schleimhaut- und Flossendefekten sinnvoll, da hier die schleimhautabdeckende
Funktion der Huminsäuren offensichtlich zum Tragen kommt.
Die Untersuchungen zur Abklärung der Ursachen für die "Neuartigen Hautveränderungen" bei
Karpfen wurden 1999 in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zoologie der Technischen Univer-
sität Dresden und 2000 mit Dr. Baska, einem Wissenschaftler der Universität Budapest, durchge-
führt. Beide Projekte zielten auf die Abklärung der ursächlichen Beteiligung von parasitären Ein-
zellern an den Hautveränderungen ab.
Durch die Untersuchungen der Hautveränderungen wurde im Jahr 2000 ein bei Karpfen bisher
nicht beschriebener Erreger nachgewiesen, der in den kommenden Jahren näher untersucht
werden soll.
Das Institut für Binnenfischerei e. V. Potsdam Sacrow stellte gemeinsam mit dem FGD Untersu-
chungen zum Einfluss der Ernährung auf die Entstehung der Hautveränderungen an.
Die Versuchsergebnisse lassen jedoch keine eindeutigen Schlussfolgerungen über eine vorbeu-
gende Wirkung einer Konditionsfütterung auf das Erkrankungsgeschehen zu.
Das Hautprogramm wurde in beiden Jahren aus Mitteln der Fischereiabgabe unterstützt.
Neben der Betreuung von Fischhaltungsbetrieben nimmt der FGD Beratungen von Kleinteichbe-
sitzern wahr, da dieses Klientel offensichtlich nicht ausreichend von praktizierenden Kollegen be-
treut werden kann.
40