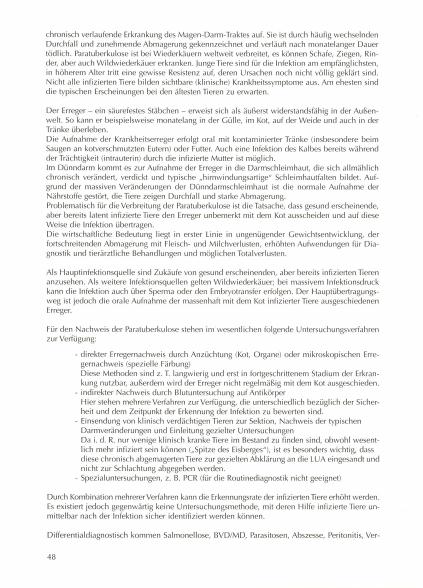
chronisch verlaufende Erkrankung des Magen-Darm-Traktes auf. Sie ist durch häufig wechselnden
Durchfall und zunehmende Abmagerung gekennzeichnet und verläuft nach monatelanger Dauer
tödlich. Paratuberkulose ist bei Wiederkäuern weltweit verbreitet, es können Schafe, Ziegen, Rin-
der, aber auch Wildwiederkäuer erkranken. Junge Tiere sind für die Infektion am empfänglichsten,
in höherem Alter tritt eine gewisse Resistenz auf, deren Ursachen noch nicht völlig geklärt sind.
Nicht alle infizierten Tiere bilden sichtbare (klinische) Krankheitssymptome aus. Am ehesten sind
die typischen Erscheinungen bei den ältesten Tieren zu erwarten.
Der Erreger - ein säurefestes Stäbchen - erweist sich als äußerst widerstandsfähig
in der Außen-
welt. So kann er beispielsweise monatelang in der Gülle, im Kot, auf der Weide und auch in der
Tränke überleben.
Die Aufnahme der Krankheitserreger erfolgt oral mit kontaminierter Tränke (insbesondere beim
Saugen an kotverschmutzten Eutern) oder Futter. Auch eine Infektion des Kalbes bereits während
der Trächtigkeit (intrauterin) durch die infizierte Mutter ist möglich.
Im Dünndarm kommt es zur Aufnahme der Erreger in die Darmschleimhaut, die sich allmählich
chronisch verändert, verdickt und typische "hirnwindungsartige" Schleimhautfalten bildet. Auf-
grund der massiven Veränderungen der Dünndarmschleimhaut
ist die normale Aufnahme der
Nährstoffe gestört, die Tiere zeigen Durchfall und starke Abmagerung.
Problematisch für die Verbreitung der Paratuberkulose ist die Tatsache, dass gesund erscheinende,
aber bereits latent infizierte Tiere den Erreger unbemerkt mit dem Kot ausscheiden und auf diese
Weise die Infektion übertragen.
Die wirtschaftliche Bedeutung liegt in erster Linie in ungenügender Gewichtsentwicklung, der
fortschreitenden Abmage'rung mit Fleisch- und Milchverlusten, erhöhten Aufwendungen für Dia-
gnostik und tierärztliche Behandlungen und möglichen Totalverlusten.
Als Hauptinfektionsquelle sind Zukäufe
von
gesund erscheinenden, aber bereits infizierten Tieren
anzusehen. Als weitere Infektionsquellen gelten Wildwiederkäuer; bei massivem Infektionsdruck
kann die Infektion auch über Sperma oder den Embryotransfer erfolgen. Der Hauptübertragungs-
weg ist jedoch die orale Aufnahme der massenhaft mit dem Kot infizierter Tiere ausgeschiedenen
Erreger.
Für den Nachweis der Paratuberkulose stehen imwesentlichen
folgende Untersuchungsverfahren
zur Verfügung:
- direkter Erregernachweis durch Anzüchtung (Kot, Organe) oder mikroskopischen Erre-
gernachweis (spezielle Färbung)
Diese Methoden sind z. T. langwierig und erst in fortgeschrittenem Stadium der Erkran-
kung nutzbar, außerdem wird der Erreger nicht regelmäßig mit dem Kot ausgeschieden.
- indirekter Nachweis durch Blutuntersuchung auf Antikörper
Hier stehen mehrere Verfahren zur Verfügung, die unterschiedl ich bezügl ich der Sicher-
heit und dem Zeitpunkt der Erkennung der Infektion zu bewerten sind.
- Einsendung
von
klinisch verdächtigen Tieren zur Sektion, Nachweis der typischen
Darmveränderungen und Einleitung gezielter Untersuchungen
Da i. d. R. nur wenige klinisch kranke Tiere im Bestand zu finden sind, obwohl wesent-
lich mehr infiziert sein können ("Spitze des Eisberges"), ist es besonders wichtig, dass
diese chronisch abgemagerten Tiere zur gezielten Abklärung an die LUA eingesandt und
nicht zur Schlachtung abgegeben werden.
- Spezialuntersuchungen, z. B. peR (für die Routinediagnostik nicht geeignet)
Durch Kombination mehrerer Verfahren kann die Erkennungsrate der infizierten Tiere erhöht werden.
Es existiert jedoch gegenwärtig keine Untersuchungsmethode, mit deren Hilfe infizierte Tiere un-
mittelbar nach der Infektion sicher identifiziert werden können.
Differentialdiagnostisch kommen Salmonellose, BVD/MD, Parasitosen, Abszesse, Peritonitis, Ver-
48