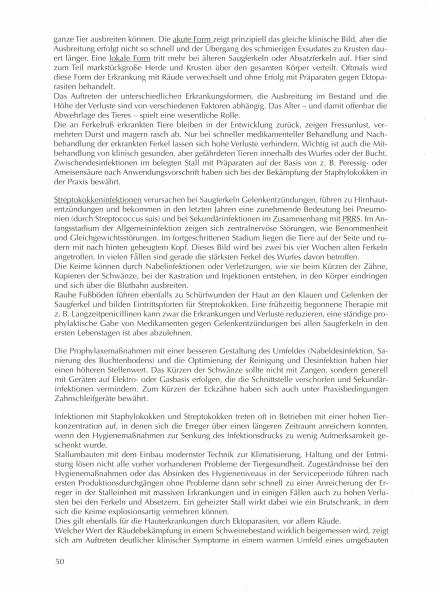
ganze Tier ausbreiten können. Die akute Forlll zeigt prinzipiell das gleiche klinische Bild, aber die
Ausbreitung erfolgt nicht so schnell und der Übergang des sehrnierigen Exsudates zu Krusten dau-
ert länger. Eine lokale Forlll tritt mehr bei älteren Saugferkeln oder Absatzferkeln auf. Hier sind
ZUIll Teil markstückgroße Herde und Krusten über den gesamten Körper verteilt. Oftmals wird
diese Form der Erkrankung mit Räude verwechselt und ohne Erfolg mit Präparaten gegen Ektopa-
rasiten behandelt.
Das Auftreten der unterschiedlichen Erkrankungsformen. die Ausbreitung im Bestand und die
Höhe der Verluste sind
von
verschiedenen Faktoren abhängig. Das Alter - und damit offenbar die
Abwehrlage des Tieres - spielt eine wesentliche Rolle.
Die an Ferkelruß erkrankten Tiere bleiben in der Entwicklung zurück, zeigen Fressunlust,
ver-
mehrten Durst und Illagern rasch ab. Nur bei schneller medikarnenteller Behandlung und Nach-
behandlung der erkrankten Ferkel lassen sich hohe Verluste verhindern. Wichtig ist auch die Mit-
behandlung von klinisch gesunden, aber gefährdeten Tieren innerhalb des Wurfes oder der Bucht.
Zwischendesinfektionen
im belegten Stall mit Präparaten auf der Basis
von
z. B. Peressig- oder
Ameisensäure nach Anwendungsvorschrift haben sich bei der Bekämpfung der Staphylokokken in
der Praxis bewährt.
Streptokokkeninfektionen verursachen bei Saugferkeln Gelenkentzündungen, führen zu Hirnhaut-
entzündungen und bekommen in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeutung bei Pneurno-
nien (durch Streptococcus suis) und bei Sekundärinfektionen
im Zusammenhang Ill~S.
lm An-
fangsstadium der Allgemeininfektion zeigen sich zentral nervöse Störungen, wie Benommenheit
und Gleichgewichtsstörungen.
lrn fortgeschrittenen Stadium liegen die Tiere auf der Seite und ru-
dern mit nach hinten gebeugtem Kopf. Dieses Bild wird bei zwei bis vier Wochen alten Ferkeln
angetroffen. In vielen Fallen sind gerade die stärksten Ferkel des Wurfes
davon
betroffen.
Die Keime können durch Nabelinfektionen oder Verletzungen, wie sie beim Kürzen der Zähne,
Kupieren der Schwänze, bei der Kastration und Injektionen entstehen, in den Körper eindringen
und sich über die Blutbahn ausbreiten.
Rauhe Fußböden führen ebenfalls zu Schürfwunden der Haut an den Klauen und Gelenken der
Saugferkel und bilden Eintrittspforten für Streptokokken. Eine frühzeitig begonnene Therapie mit
z. B. Langzeitpenicillinen kann zwar die Erkrankungen und Verluste reduzieren, eine ständige pro-
phylaktische Gabe
von
Medikaillenten gegen Gelenkentzündungen bei allen Saugferkeln in den
ersten Lebenstagen ist aber abzulehnen.
Die Prophylaxemaßnahmen mit einer besseren Gestaltung des Umfeldes (Nabeldesinfektion, Sa-
nierung des Buchtenbodens) und die Optimierung der Reinigung und Desinfektion haben hier
einen höheren Stellenwert. Das Kürzen der Schwänze sollte nicht mit Zangen, sondern generell
mit Geräten auf Elektro- oder Gasbasis erfolgen, die die Schnittstelle verschorfen und Sekundär-
infektionen vermindern. ZUIll Kürzen der Eckzähne haben sich auch unter Praxisbedingungen
Zahnschleifgeräte bewährt.
Infektionen mit Staphylokokken und Streptokokken treten oft in Betrieben mit einer hohen Tier-
konzentration auf, in denen sich die Erreger über einen längeren Zeitraum anreichern konnten,
wenn den Hygienemaßnahmen zur Senkung des Infektionsdrucks zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt wurde.
Stallumbauten mit dem Einbau modernster Technik zur Klirnatisicrung, Haltung und der Entrni-
stung lösen nicht alle vorher vorhandenen Problerne der Tiergesundheit. Zugeständnisse bei den
Hygienemaßnahmen oder das Absinken des Hygieneniveaus in der Serviceperiode führen nach
ersten Produktionsdurchgängen ohne Problerne dann sehr schnell zu einer Anreicherung der Er-
reger in der Stalleinheit mit massiven Erkrankungen und in einigen Fällen auch zu hohen Verlu-
sten bei den Ferkeln und Absetzern. Ein geheizter Stall wirkt dabei wie ein Brutschrank, in dem
sich die Keime explosionsartig vermehren können.
Dies gilt ebenfalls für die Hauterkrankungen durch Ektoparasiten,
vor
allem Räude.
Welcher Wert der
Raudebekämpfung
in einem Schweinebestand wirklich beigemessen wird, zeigt
sich arn Auftreten deutlicher klinischer Symptome in einem warmen Umfeld eines umgebauten
50